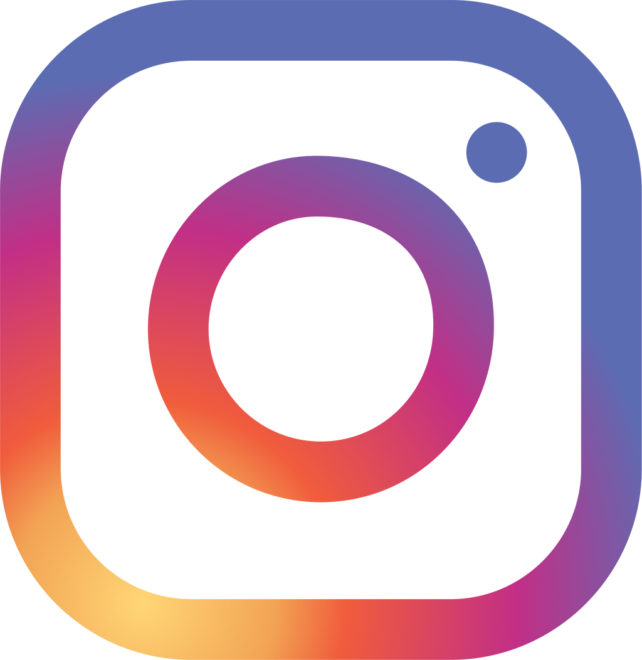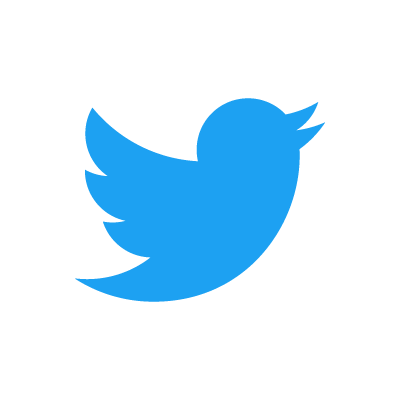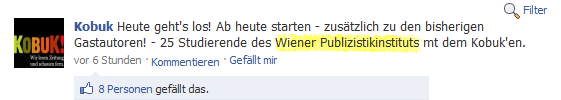Zum Glück ist „Die Presse“ kein Arzt. Sonst hätt ich ein bisserl Angst vor der nächsten Spritze mit 1,0ml Wirkstoff (von der Mehrbelastung für die Krankenkassen ganz zu schweigen).
 Ein weltbekannter Promi, eine romantische Landschaft und eine grausam zugerichtete Leiche: Das ist der Stoff aus dem Träume gemacht sind, zumindest die eines Boulevardjournalisten. In unserem Fall ist die romantische Landschaft der Comer See, der weltbekannten Promi heißt George Clooney und auch die Leiche gab es tatsächlich. Die Mischung ist perfekt und dementsprechend groß war das Medieninteresse. Blöd nur, dass die Leiche und Clooney so gar nicht zusammenpassen wollten. Denn wie das BildBlog berichtete, trieb die Leiche bereits mehrere Tage im 146 Quadratkilometer großen Comer See als sie „weniger als einen Kilometer“ entfernt von Clooneys Villa gefunden wurde. Dem Schweizer „Blick“ war das nicht nah genug und aus „weniger als einem Kilometer“ wurden prompt „wenige Meter“.
Ein weltbekannter Promi, eine romantische Landschaft und eine grausam zugerichtete Leiche: Das ist der Stoff aus dem Träume gemacht sind, zumindest die eines Boulevardjournalisten. In unserem Fall ist die romantische Landschaft der Comer See, der weltbekannten Promi heißt George Clooney und auch die Leiche gab es tatsächlich. Die Mischung ist perfekt und dementsprechend groß war das Medieninteresse. Blöd nur, dass die Leiche und Clooney so gar nicht zusammenpassen wollten. Denn wie das BildBlog berichtete, trieb die Leiche bereits mehrere Tage im 146 Quadratkilometer großen Comer See als sie „weniger als einen Kilometer“ entfernt von Clooneys Villa gefunden wurde. Dem Schweizer „Blick“ war das nicht nah genug und aus „weniger als einem Kilometer“ wurden prompt „wenige Meter“.
Diesem Augenmaß schloss sich auch bild.de an, bis die Frauenleiche auf netplosiv.org letztlich direkt vor dem Haus des Hollywoodstars aufgefunden wurde. Auch die Online-Ausgabe der Zeitung „Österreich“ wollte dem um nichts nachstehen und packte die Angabe gleich in die Überschrift. Bei „Österreich“ hat man aber natürlich auch selbst recherchiert und Clooneys Haus unter die Lupe genommen: „Umgeben ist es von riesigen Mauern und damit absolut blickdicht. Es dürfte also unwahrscheinlich sein, dass er selbst die Leiche entdeckt hat.“ Diese Logik ist freilich bestechend. Eigentlich schade, dass die riesigen Mauern nirgends zu sehen sind.
Falschmeldungen dürfte Clooney aber bereits gelassen sehen. Erst im Februar 2010 berichteten Medien über seinen angeblichen Hausverkauf. Und das kommentierte er dann so: „Die Geschichte ist erfunden, von anderen aufgegriffen und hiermit dementiert worden. Ende eines neuen Tages mit falschen Meldungen“. Dem kann man wohl nichts mehr hinzufügen.
Bild: Haus von Clooney. cc Holly Hayes
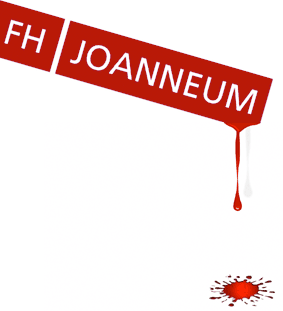 Unter Mitarbeitern des Studiengangs Journalismus der Grazer Fachhochschule Joanneum tobt ein schmutziger Kampf, der inzwischen die Öffentlichkeit erreicht hat. Im Raum stehen Urkundenfälschung, Verleumdung und so einiges mehr. Gekämpft wird auch und vor allem über Medien, die Akteure verstehen ihr Handwerk schließlich.
Unter Mitarbeitern des Studiengangs Journalismus der Grazer Fachhochschule Joanneum tobt ein schmutziger Kampf, der inzwischen die Öffentlichkeit erreicht hat. Im Raum stehen Urkundenfälschung, Verleumdung und so einiges mehr. Gekämpft wird auch und vor allem über Medien, die Akteure verstehen ihr Handwerk schließlich.
Für Kobuk wird es dann interessant, wenn sich einzelne Redakteure allzu offensichtlich instrumentalisieren lassen, oder zumindest „vergessen“ auf mögliche Interessenskonflikte hinzuweisen. So geschehen beim heutigen Artikel in der „Presse“ zur Causa.
In diesem schreibt der Presse-Redakteur Alexander Bühler, ein ehemaliger Lehrbeauftragter der FH und laut Beobachtung eines Studenten mit einem Hauptakteur des Intrigenstadels befreundet, aus der scheinbaren Warte der Objektivität über die Causa, ohne auf seine Befangenheit hinzuweisen.
Der Studiengangsleiter Heinz M. Fischer, je nach Perspektive mutmaßlicher Unkundenfälscher oder Opfer einer Schmutzkübelkampagne, beklagt diese Befangenheit in einem offenen Brief an Presse-Chefredakteur Fleischhacker:
Mit gewissem Erstaunen, wohl aber auch mit einer bestimmten Irritation habe ich in der heutigen Ausgabe der Presse den Artikel „Gefälschte Tests, unfaire Noten? Anzeigen gegen Grazer FH“ rezipiert; eröffnet er mir doch neue, bisher unbekannte Perspektiven von Qualitätsjournalismus, für den die Presse angeblich steht (oder gestanden ist), diesen Anspruch womöglich aber auch schon über Bord geworfen hat.
Studierende der FH haben inzwischen eine Facebook-Page gegründet, mit der sie ihre Uni gegen die „lächerlichen“ und „an den Haaren herbei gezogenen“ Vorwürfen in Schutz nehmen wollen.
Disclaimer: Ich bin mit dem FH-Lehrer Heinz Wittenbrink, der laut Eigendarstellung in dieser Sache befangen ist, befreundet.
Update: Michael Fleischhacker hat auf den offenen Brief geantwortet. Auf den Vorwurf der Befangenheit geht er jedoch nicht ein.
Die Qualität der Medien ist immer auch ein Indiz für die Qualität der Demokratie, meint der Schweizer Mediensoziologe Kurt Imhof. Welche dramatischen Auswirkungen medialer Qualitätszerfall haben kann, erklärt er im bemerkenswerten Interview auf science.orf.at.
(Foto cc practicalowl)
Da Sie gerade diesen Artikel lesen, ist Ihnen vermutlich aufgefallen, dass Kobuk.at mittlerweile mit vollem Elan am Start ist. Doch auch ein Medien-Watchblog kann sich mal irren. So geschehen auf der Facebook-Page von Kobuk, in der voller Stolz über die 25 neuen Publizistik-Studenten berichtet wurde, die nun am Blog mitwirken:
Blöd nur, dass ca. ein Drittel dieser Studierenden eigentlich vom Informatik-Institut stammen und nur „leihweise“ am Publizistik-Institut studieren. Aber was wäre ein Watchblog wenn man sich nicht auch mal selbst überwachen würde?

In der Sonntagsausgabe von „Österreich“:
Das sind die besten Adressen für Netzwerker […]
www.twitter.com 150 Zeichen, die die Welt bedeuten — hier postet jeder, der wichtig ist.
Netzwerker wissen: Das sind genau zehn Zeichen zuviel.
Aber gut, das behaupten manche über „Österreich“ auch.
Via @snuup, @jakkse, @ClaudiaZettel, @noxvobiscum, @stoffl_p, @robertharm, @kaphorst
Mangelnde Geschichtskenntnisse in der dpa und den angeschlossenen Redaktionen adeln eine altbekannte Tatsache zur neu entdeckten Sensation. Zufällig ist dabei auch ein 2009 erschienenes Buch im Spiel, das sein umtriebiger Autor geschickt zu vermarkten weiß. Aber der Reihe nach. Beginnen wir 1988, mit diesem kurzen Buchauszug:
Wer die These vom im Leben verarmten Mozart, der hoch verschuldet und im Armengrab bestattet gewesen sein soll, erfunden hat, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Das Bild des „verarmten Genius Mozart“ stammt jedenfalls aus der Romantik. Jeder Biograph versuchte, Mozart noch ärmer zu machen […] Ist etwa jemand verarmt, der mit 35 Jahren ein Industrielleneinkommen hat, eine noble Wohnung sich leistet, ein Reitpferd besitzt — das kommt heute einem hochkarätigen Luxuswagen gleich –, ein Billardspiel und Zimmer dazu besitzt?
„Collectanea Mozartiana“, Mozartgemeinde Wien (1988)
Dass Mozart, entgegen der Legende, ganz ausgezeichnet verdiente — obgleich davon durch seinen ausschweifenden Lebensstil wenig blieb — ist also schon lange bekannt. Und spätestens seit 2004, als auch in der Wikipedia Mozarts Jahreseinkommen auf umgerechnet ca. 125.000 EUR beziffert wurde, handelt es sich dabei um kein geheimes Offline-Wissen mehr.
Außer für die Deutsche Presse-Agentur. Diese berichtete nämlich am 5. April 2010, also ca. 22 Jahre nach meiner Buchquelle, fast sechs Jahre nach Wikipedia und drei Jahre nach dem „Mozartjahr“, diese sensationelle Neuigkeit aus einem (fast) druckfrischen Buch:
Mozart war keinesfalls ein armer Schlucker, das Musikgenie hat aber weit über seine Verhältnisse gelebt. In akribischer Recherchearbeit will dies ein Team um den Salzburger Autor und Mozartforscher Günther G. Bauer nachgewiesen haben.
Nachzulesen ist das in seinem Buch „Mozart. Geld, Ruhm und Ehre“. Am 10. April stellt Bauer seine bereits im vergangenen Jahr erschienene Arbeit in der Salzburger Stadtbibliothek vor.
[…] Fünf Jahre hat das 24-köpfige Team führender internationaler Mozartforscher – von Salzburg und Wien über Zürich bis Tokio – die Finanzen von Mozart in dessen Wiener Jahren (1781-1791) bestmöglich auf Kreuzer und Pfennig recherchiert und nachgerechnet. Das Ergebnis: „Er war doppelt so reich, als man bisher wusste. Er hatte in dieser Zeit ein Jahreseinkommen von durchschnittlich 5000 Gulden“, sagt Bauer. Die Umrechnung früherer Währungen ist problematisch, aber laut Bauer könnten dies heute bis zu 150 000 Euro sein.
[…] Das Bild vom „armen Mozart“ stimmt also nur insoweit, als dass „Wolferl“ mit seinem vielen Geld nicht auskam: „Mozart hat sein Geld verlebt in einem eigentlich aristokratischen Lebensstil, der ihm nicht zugestanden ist“, erläutert Bauer.
Ein Buch, in dem scheinbar genauer nachgerechnet wurde, das aber nüchtern betrachtet, keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse bringt und bereits seit über einem halben Jahr auf dem Markt ist, wird plötzlich zur Nachricht. Und dann noch das „24-köpfige Team führender internationaler Mozartforscher“, obgleich nur ein Name am Cover steht. Eigentlich hätte spätestens bei derart bescheidener Selbstdarstellung jemand stutzig werden und kritisch nachfragen müssen. Aber stattdessen wird lieber Geschichte geschrieben. Oder genauer, auf gut österreichisch, a Gschichtl druckt:
Mozart war Großverdiener – und Verschwender (krone.at, 5.4.2010)
Neues [sic!] Buch zu Mozarts Leben: Reicher Geldverschwender (tt.com, 5.4.2010)
Enthüllt: Mozart spielte 150.000 Euro im Jahr ein!
Von wegen armer Schlucker […] (heute.at, 6.4.2010)
Zumindest der Online-Redaktion der „Presse“ hätte dabei aber schon was auffallen können:
Mozart war Spitzenverdiener, kein armer Schlucker
Das musikalische Genie verdiente außergewöhnlich gut, haben Forscher nun [sic!] herausgefunden.[…] Das weist ein Forscherteam um den Salzburger Autor und Mozartforscher Günther G. Bauer nun [sic!] nach.
Die Presse, 6.4.2010
Und direkt daneben verlinkt „AUS DEM ARCHIV“:
Maestro Mozart, der Millionär
Die Einkommenssituation von Wolfgang Amadeus Mozart dürfte viel besser gewesen sein, als die Forschung bisher dachte. ein „verarmtes Genie“ war er jedenfalls sicher nicht.[…] Folgt man Günther G. Bauer, dem ehemaligen Rektor der Universität Mozarteum in Salzburg, dann verdiente Mozart außerordentlich gut.
Die Presse, 30.1.2010
Offenbar hat das Buch vor der dpa heuer schon mal ne kleinere Runde in den österreichischen Medien gedreht. Und „Die Presse“ wiederholt, schwer begeistert oder vergesslich, ihre Empfehlung nun im Vierteljahrestakt. Passend zu Mozart, irgendwie.
Der Amazon-Link zu Buch und Provision ist praktischerweise auch gleich mit dabei. Den Verkaufsrang (292.758, bzw. unter Mozartbüchern 49 von ca. 100) scheint dies allerdings noch nicht wesentlich beflügelt zu haben. Ob’s am Blatt liegt oder am Buch? Ein 42-köpfiges Team internationaler Medienwatchblogger wird dies in den nächsten Jahren klären.
Sachdienliche Hinweise könnten aber bereits jetzt die Leserkommentare unter dem älteren der beiden Presse-Artikel liefern. Ich gebe hier mal einige dieser persönlichen Meinungen wieder. Ausnahmsweise ungeprüft und unrecherchiert — sollen ruhig auch noch ein paar Journalisten ihre Arbeit tun…
Die zahllosen Peinlichkeiten in Bauers neuem Buch
beginnen schon damit, dass er das Bild von Cignaroli „Miozart im blauen Morgenmantel“ für echt hält. Bauers grobe Unkenntnis der Mozart-Literatur und seine Unbedarftheit als abslouter Nicht-Historiker können angesichts hier des vorgeführten Publicity-Aufwands nur verwundern.Re: Die zahllosen Peinlichkeiten in Bauers neuem Buch
Ein sehr seltsames Buch. Das beginnt schon mit dem peinlichen Namedropping in einer Liste von „Mitarbeitern“, von denen manche nur eine Frage oder ein E-Mail beantwortet haben und sich einer gegen die Vereinnahmung nicht wehren kann, weil er lange tot ist. Besonders kurios wird es, wenn sich der Autor gescheiter als Mozart selbst gebärdet: „Die Kutschenfahrten kosteten mehr als der Komponist vermutete“! (S. 82)Re: Re: Die zahllosen Peinlichkeiten in Bauers neuem Buch
Dass Mozart viel Geld verdient und nicht gratis gelebt hat, wussten wir schon. Der Autor hat die „Genaue Rechnungstafel“ von 1788 gefunden, fasst aber sonst nur die fehlerhafte Sekundärliteratur zusammen. Er hält den Deiner-Bericht für echt, glaubt, dass der Eingang des Camesina-Hauses in der Domgasse 5 lag und wenn er behauptet, Mozart habe anlässlich der Begräbnisse seiner Kinder Leichenschmäuse(!) veranstaltet, so wird klar, dass das Wien des 18. Jahrhunderts für Bauer ein total fremder Planet bleibt.
Den Haupttreffer in dieser ganzen Geschichte landete allerdings zweifellos eine Autorin beim deutschen Tagesspiegel. Sie war von der scheinbar neuen Scheinerkenntnis so aufgewühlt, dass sie ihren Artikel zur Hälfte dem Irrtum an sich widmete. Und dessen mögliche Auswirkungen auf die Rezeption von Mozarts Werk. Der Irrtum im Irrtum sozusagen. Trotz falscher Prämisse und Verkennung der Fakten, ein meisterhaft formuliertes kulturphilosophisches Highlight, mit tröstenden Aspekten für alle Beteiligten (zur Gänze hier nachzulesen):
Champagner für Mozart
Christiane Peitz schreibt die Musikgeschichte um [sic!]Die Wissenschaft hat festgestellt: Mozart war doch nicht arm. Er hat nur über seine Verhältnisse gelebt.
[…] Aber klingt die Jupiter-Symphonie anders, wenn wir wissen, dass ihr Schöpfer weniger Wasser als Wein trank?
[…] Der Mensch mag Irrtümer gerne. […] Irrtümer bringen die Menschheit weiter. Ähnlich wie der Zweifel sind sie die fröhlichen Anarchisten im Wissensbetrieb. Nichts ist sicher, keine Erkenntnis ist in Stein gemeißelt, nicht mal die eigene. Es lohnt sich, die Welt jeden Tag neu zu erfinden. Ich irre mich, also bin ich. […]
 Einen Tag nachdem alle Welt über das durch Wikileaks.org veröffentlichte Video eines US-Kampfeinsatzes aus Bagdad berichtete, wurde nun auch ORF.at aufmerksam. Doch die Vorbereitungszeit reichte offenbar nicht ganz für saubere Recherche:
Einen Tag nachdem alle Welt über das durch Wikileaks.org veröffentlichte Video eines US-Kampfeinsatzes aus Bagdad berichtete, wurde nun auch ORF.at aufmerksam. Doch die Vorbereitungszeit reichte offenbar nicht ganz für saubere Recherche:
Die Whistleblower-Website Wikileaks hatte das rund zwölfminütige Interview, das ein Feuergefecht eines Militärhubschraubers im Osten Bagdads vom 12. Juli 2007 zeigt, online gestellt.
Mit einem „Interview“ dürfte das brutale Videoprotokoll aus einem Kampfhubschrauber (mit den Stimmen aus zwei Hubschraubern und Basis) so viel gemein haben wie der Irakkrieg mit der Schlacht von Gaugamela. Das Rohmaterial reicht zudem über 38 Minuten, der Zusammenschnitt des Videos dauert immerhin noch fast 18. Soviel zu den „zwölf Minuten“.
Über die gegenüber dem Pentagon erhobenen Vorwürfe steht im Teaser zum Artikel nur so viel:
„Wie in einem Computerspiel“ hätten sich die Soldaten verhalten, lautet die Kritik an der Schießerei mit fatalen Folgen.
Klingt etwas nach der Begründung für das Durchfallen-Lassen eines Fahrschülers bei der Führerscheinprüfung. Doch die die Vorwürfe lauten etwa „grundloses Ermorden eines verwundeten Reuters-Mitarbeiters und seiner Retter“:
The video (..) clearly shows the unprovoked slaying of a wounded Reuters employee and his rescuers.
Auch die vorsätzliche Tötung weiterer, unbeteiligter Zivilisten wird von den Kritikern in den Raum gestellt. Ohne über diese konkreten Vorwürfe („slaying“, „murder“) zu berichten, möchte der Autor möglicherweise Verständnis für die schwierige Aufgabe der mutmaßlichen Täter wecken:
Wie selten zuvor gewährt dieses Video Einblicke in die Schwierigkeiten und Abgründe der modernen Kriegsführung.
Das deutlich hörbare Amüsement der Soldaten nach erfolgter Tötung und bei der Beobachtung des Überrollens einer Leiche durch ein Truppenfahrzeug bleibt jedoch ebenso unerwähnt.
Auf ein Einbetten des fraglichen Videos in den Artikel zur eigenen Meinungsbildung des Lesers, wie in den meisten internationalen Medien geschehen, verzichtet der ORF. Lediglich ein 3-Minuten-Ausschnitt, der erst nach drei Klicks erreichbar ist, wird auf die eigene Website gestellt. Dabei wäre es so einfach gewesen:
Update: Erste Korrekuren werden bereits vorgenommen: Jetzt ist nicht mehr von einem Interview die Rede, dafür wurden die Vorwürfe präzisiert.
Die Kronen Zeitung berichtete jüngst über diesen zu Herzen gehenden Fall später Gerechtigkeit:
Enkel fand flüchtigen Mörder seines Opas
[…] Clem Pellet hat den Mörder seines Großvaters 38 Jahre nach dessen Flucht aus der Haft im US-Staat Arizona wiedergefunden. Der inzwischen 78-jährige Frank Dryman muss jetzt lebenslang hinter Gitter.
Schöne Geschichte. Leider nur halb so spannend, wenn man sie in einer seriösen Zeitung oder Agenturmeldung nachliest. Der Mörder war nämlich keineswegs „aus der Haft“ geflohen. Er hatte knapp 15 Jahre abgesessen und befand sich bereits mehrere Jahre in Freiheit, auf Bewährung. Eines Tages tauchte er dann unter, womit er sich erneut straffällig machte. Was übrigens auch krone.at einige Tage vor dem Printartikel noch wusste.
Ob der Mann nun erneut auf Bewährung frei kommt oder zurück ins Gefängnis, wird voraussichtlich erst im Mai entschieden. Dass er „jetzt lebenslang hinter Gitter“ muss, ist daher eine weitere frei erfundene Zuspitzung für den Boulevard.
Die Krone erzählt weiter:
[…] Der Privatdetektiv stieß […] auf ein Alias von Dryman — Victor Houston. Einen Mann mit diesem Namen und dem richtigen Alter gab’s nur in Arizona City. Der Detektiv verständigte die Polizei, die Houston anhand von Fingerabdrücken als Dryman identifizierte und festnahm.
Diese Version der Geschichte deckt sich ebenfalls mit keiner verfügbaren Quelle und dürfte daher auch frei erfunden sein.
Medien vor Ort berichten, der Detektiv verfolgte die Spur von Drymans Sozialversicherungsnummer bis zur Hochzeitskapelle des Städtchens Arizona City. Dort fragte er „Victor Houston“, den Inhaber der Kapelle, nach „Frank Valentine“ (einem früheren Alias des Flüchtigen). Bei der Befragung fielen dem Ermittler an „Houstons“ Händen Tatoos auf, die zwar verändert worden waren, aber jenen von Dryman ähnelten. Auch das Alter des Mannes schien in etwa zu passen. Die hinzugezogene Polizei fand die Fingerabdrücke „Houstons“ zwar überraschenderweise nicht in der nationalen Datenbank, aber die Übereinstimmungen mehrerer Tatoos am Körper waren erdrückend. Nach kurzem Verhör gestand er daher seine wahre Identität.
Das ist schon irgendwie erstaunlich. Die Krone bekommt eine Agenturmeldung. Gibt diese in ihrer Online-Ausgabe korrekt wieder. Lässt sie dann einige Tage in der Redaktion abliegen. Und erzählt in der gedruckten Ausgabe die Geschichte dann so, als wäre sie bereits einige Generationen mündlich ums Lagerfeuer gegangen.
Aber vielleicht ist das ja das Geheimnis einer „guten“ Krone-Story…?