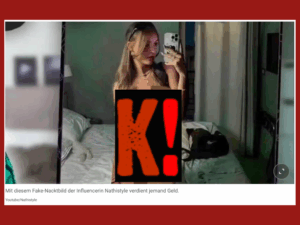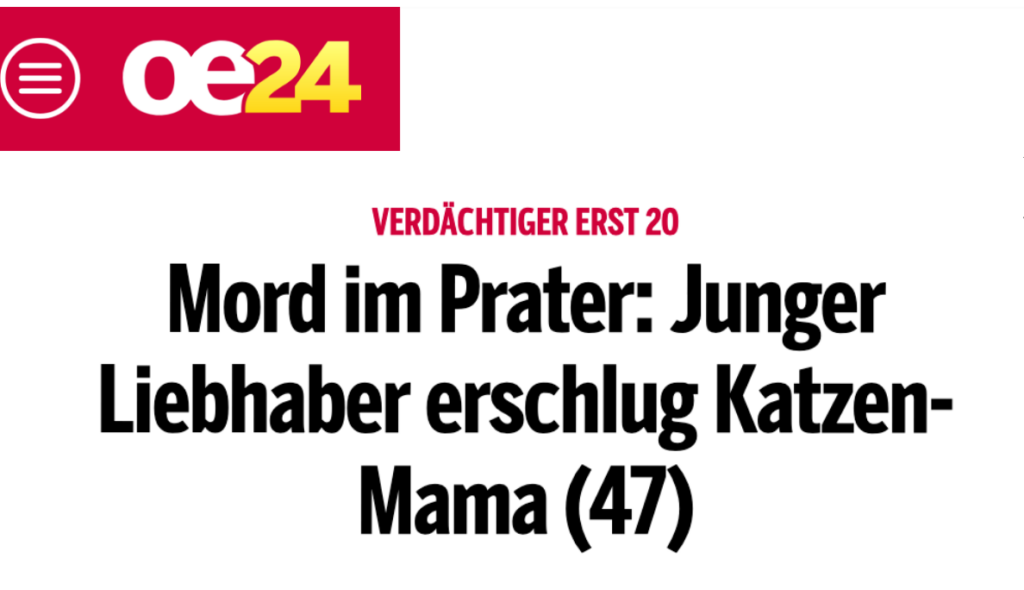Sebastian Kurz lädt ausgewählte Medienvertreter:innen nach Tel Aviv ein – sie sollen sein neues Projekt „Dream“ kennenlernen, ein KI-Start-up. Die meisten Medien kennzeichnen nicht, dass „Dream“ die Reise bezahlt hat. Und auch inhaltlich rückt das Unternehmen in den Hintergrund: Die Berichte drehen sich vor allem um Kurz.
Vergangenes Wochenende lud Sebastian Kurz einige deutsche und österreichische Journalist:innen ein, sein Unternehmen „Dream“ in Israel zu besichtigen. Oder wie die Kronen Zeitung schreibt: Er führte durch „sein sagenumwobenes und milliardenschweres Reich in Tel Aviv“. Das klingt tatsächlich wie die Einladung, eine „Traum“-Welt zu betreten, und genau so lesen sich auch viele der Berichte quer durch die Medien.
KI scheint heute fast alles zu können: Schreiben, rechnen, singen oder gar schauspielern. Aber auch Menschen ausziehen, die nie nackt vor der Kamera gestanden sind. Immer häufiger kursieren im Netz täuschend echte Nacktbilder, generiert von künstlicher Intelligenz: sogenannte Deepfake-Nudes. Betroffen sind oft Prominente – vor allem junge Frauen. Heute.at berichtet gerne über solche Fälle – und verbreitet dabei die problematischen Nacktbilder munter weiter.
„Jemand macht Geld mit Fake-Nacktbildern von mir“: Ja, die Heute-Zeitung!
Im Frühjahr dieses Jahres berichtete Heute.at über die Schweizer Influencerin nathistyle. Ein Mann habe sie über alle Kommentarspalten hinweg mit Nachrichten bombardiert, ihr eine „Betrugsmasche“ vorgeworfen und damit gedroht, die Polizei einzuschalten. In Wirklichkeit war der Mann auf ein gefälschtes Profil hereingefallen, das sich als die Influencerin ausgab. Der Person hinter diesem Profil hatte der Mann dann Geld überwiesen, und zwar in der Erwartung, dafür Nacktbilder von der Influencerin zu erhalten. Diese wurden mit KI erstellt.
Das Titelbild, das die Heute-Redaktion auswählt, zeigt jedoch ausgerechnet das Deepfake-Nude selbst: scheinbar nathistyle, nackt in einem Spiegel-Selfie. Im ursprünglich auf Instagram veröffentlichten Originalfoto trägt die Frau ein weißes Kleid, das im Bild dann digital entfernt wurde. Darüber kleben nun nur noch eine Handvoll hautfarbener Pixel.
Die Heute-Redaktion schreibt unter dem Bild:
„Mit diesem Fake-Nacktbild der Influencerin Nathistyle verdient jemand Geld.“
Genau. Nämlich nicht nur die Person hinter dem Fake-Profil, sondern auch Heute.at selbst.
Die Bundesregierung kürzt die Inserate. Die Gratiszeitungen Heute und Oe24 trifft das ganz besonders. Dass Medienminister Babler nun auch „Qualitätskriterien“ bei der Fördervergabe verankern will, macht ihn dort erst recht zum Buhmann.
„Regierung ruiniert Österreichs Medien“, „Mega-Skandal: Regierung zahlt 14 Mio. an Fake-News“, „Wie sich Medienminister bei Medien blamiert“ – in den Gratiszeitungen Heute und Oe24 hat man sich vergangene Woche besonders an Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler abgearbeitet.
Während ihn Oe24 „höchstpersönlich zum Totengräber der heimischen Medien-Szene“ macht, attestiert Heute einen medienpolitischen „Babler-Blindflug“ – und wirft ihm sowohl „Speed kills“-Taktiken als auch ein „auf die lange Bank schieben“ vor.
Die Medienbranche steckt in einer Krise – und bei den beiden Gratiszeitungen hat man den Schuldigen bereits gefunden. Dabei nimmt man es mit Zahlen, Daten und Fakten nicht immer ganz so genau.
In den Stunden und Tagen nach dem Amoklauf in Graz zeigten einige Medien eine besonders unrühmliche Seite – geprägt von Spekulationen, verstörenden Bildern und unangebrachten Besuchen.
Am Dienstag erschütterte ein Amoklauf an einer Grazer Schule das ganze Land. Während Einsatzkräfte versuchten, die Lage unter Kontrolle zu bringen und Angehörige betreut wurden, übertrafen sich viele Medien in medienethischen Verfehlungen: Sie spekulierten über Motive, zeigten Aufnahmen der Opfer und veröffentlichten identifizierendes Material. Ein Überblick über die schwerwiegendsten Verstöße gegen journalistische Sorgfaltspflichten der letzten beiden Tage.
Klicks über alles – das Problem mit dem Opferschutz
„Österreichische Kinder verlernen deutsche Sprache“ titelt die Gratiszeitung Heute am 29. März. In der Sub-Headline heißt es weiter: „In vielen Kindergärten kommen deutsch-sprechende Kinder laut einer Studie unter die Räder.“ Ein „Kindergarten-Schock“ sei das. Angeblich, berichtet Heute weiter, würden laut einer aktuellen Studie österreichische Kinder in Kindergärten mit mehrheitlich nicht-deutschsprachigen Kindern vergessen, wie man Deutsch spricht.
Das Problem dabei: Die besagte Studie lässt diesen Schluss überhaupt nicht zu.

Wo Worte fehlen, sprechen Bilder – doch nicht immer sind es die richtigen. Eine Analyse von Symbol- und Stockbildern in Kronen Zeitung, Heute und Der Standard zeigt, wie stark stereotype Darstellungen von Frauen das mediale Bild prägen: Fast alle sind jung, weiß, hübsch und schlank.

Diese Bilder aus den Gesundheits-Rubriken von Kronen Zeitung und Heute lassen glauben, nur weiße Frauen mittleren Alters werden krank.
Zeitungen haben es nicht immer leicht. Um in der Branche vorne mitzuspielen, muss man schnell sein und kann keinen Diskurs auslassen. Über 100 Artikel pro Tag in Print und auf der Website sind in vielen Redaktionen Normalzustand. Und wenn man als eifrige News-Journalistin dann auch noch schnell einen Artikel über ein sperriges Thema wie Aktienfonds, den Arbeitsmarkt oder Datenschutz schreiben muss, kann das passende Bild dazu zu finden, zum Problem werden. Genau hier kommen häufig Stockbilder zum Einsatz.
„Festnahme nach Mordverdacht“ lautet die Polizeimeldung am Morgen des 19. Februar. Keine fünf Stunden später hat die Gratiszeitung Oe24 schon ihr eigenes Bild konstruiert:
„Beide sind aus Wien und trotz des großen Altersunterschiedes offenbar ein Liebespaar“, spekuliert Oe24 wild drauflos. Zeitgleich stellt die Polizei fest: „In welchem Verhältnis die beiden stehen, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“
Doch nicht nur mit Oe24 geht die Fantasie durch. Auch die Krone titelt „Frau in Liebesnest getötet“, spricht von ihr als „die ältere Sexpartnerin“ und dem Täter als „ihre nicht mal halb so alte Turtelei“. Auf Heute.at ist man sich ebenso sicher, das Opfer sei die „Liebhaberin“.
Die Gratiszeitung Heute gibt freiheitlichen Aufreger-Geschichten viel Raum, übernimmt gerne FPÖ-Sprech und pflegt sogar einen gewissen Kickl-Kult. Warum?
„‚Hören Sie genau zu‘ – FPÖ-Chef Kickl sagt jetzt ALLES“ verspricht Heute.at vergangenen Donnerstag. Blau-schwarz ist am Vortag offiziell gescheitert. Und wer es nicht zur Primetime in der ZIB verfolgt hat, kann nun Kickls „45 Minuten Klartext“ im Wortlaut auf dem Onlineauftritt der Gratiszeitung nachlesen. Dabei wurde die Kickl-Rede schon Mittwochabend unter dem Titel „FPÖ-Chef packt aus“ in großen Teilen für Heute-Leser transkribiert.
Freiheitliche Botschaften bekommen im Heute-Universum viel Raum. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht aus einer Presseaussendung oder einem Social-Media-Posting der Freiheitlichen ein Bericht gemacht wird. Mit den journalistischen Kriterien Relevanz und Richtigkeit nimmt es die Online-First-Redaktion von Heute, seit Oktober 2023 geführt von Chefredakteur Clemens Oistric (33), dabei nicht immer so genau. Das ergab eine Kobuk-Auswertung von Geschichten und Kommentaren über die FPÖ rund um die Nationalratswahl 2024. Diese Anbiederung bringt dem Blatt aus seiner Sicht einige Vorteile: Exklusive Sager, mehr Klicks und eine Zweitverwertung in FPÖ-nahen Kanälen.
In zahlreichen Medien ist zu lesen, dass Österreichs Luftraum „unüberwacht“ sei. Das hat faktisch nie gestimmt. Das Verteidigungsministerium dementierte die Berichte allerdings nicht – und hat dafür offenbar Gründe.
„Luftraum über Österreich seit Freitag ungeschützt“, berichtet die Kronen Zeitung am 17. November. Und weiter: „Seit Freitagnachmittag kann am Himmel über Österreich theoretisch jeder machen, was er will.“ Man meint einen neuen Missstand beim österreichischen Bundesheer aufgedeckt zu haben.
Zahlreiche Medien übernahmen die Geschichte, mal reißerischer, mal weniger. Die Kernbotschaft vermittelten sie jedenfalls allesamt: Der Luftraum über Österreich sei ungeschützt. Neben Heute und Oe24 verbreiteten auch Der Standard, Kurier und der ORF die Schreckensnachricht.
Dabei hätte schon ein bisschen Recherche gereicht, um erstens die Fakten zu ermitteln und zweitens den Spin zu riechen, der hier offenbar verbreitet wurde.
Doch der Reihe nach. Mit „Luftraum ungeschützt“ ist gemeint, dass am 16. und 17. November die Eurofighter nicht starten konnten. Der Grund dafür ist ein Überstundenabbau bei Fluglotsen.
In vielen österreichischen Onlinemedien erscheint regelmäßig Werbung für illegale Online-Casinos. Dazu kommt noch Werbung für legales Glücksspiel, die oft nicht als solche zu erkennen ist. Unsere Recherche zeigt: Das sind keine Einzelfälle, sondern hat System.