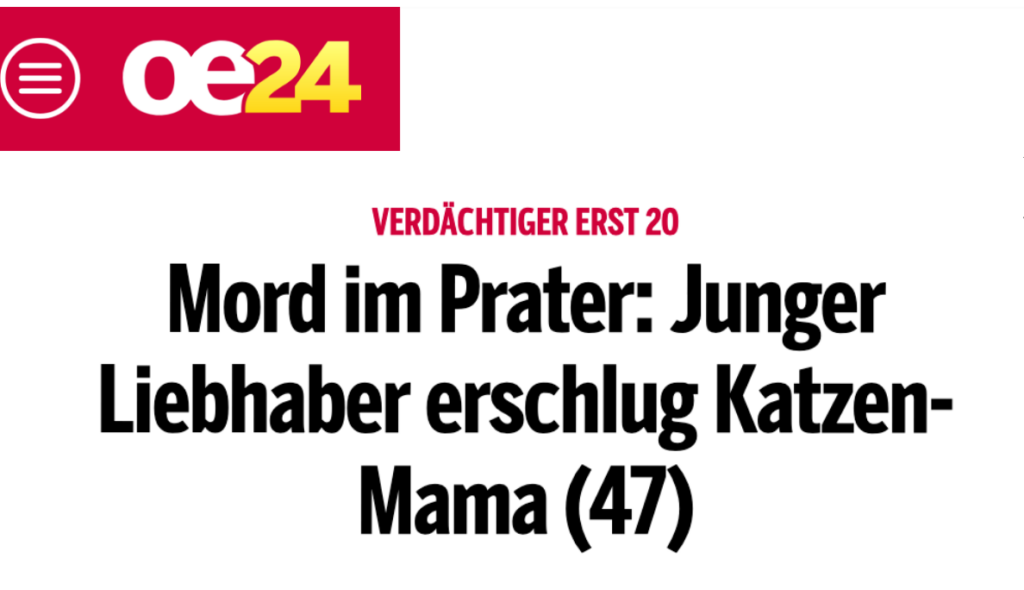Eine Gruppe homophober Schläger verprügelt systematisch junge Männer. Die Gruppe tarnt ihre Hassverbrechen und behauptet, sie würde Pädophile jagen. Medien tappen in die Falle: Sie übernehmen das Framing der Kriminellen viel zu unkritisch und verzerren so, worum es bei den Straftaten wirklich geht. Denn keines der Opfer war tatsächlich pädophil.
„Razzien: Polizei geht gegen Pädophilen-Jäger vor“, berichtet die Kronen Zeitung am Morgen des 21. März 2025. „Laut ‘Krone’-Infos handelt es sich um eine Aktion gegen die sogenannte ‘Pedo-Hunter-Szene’, die Selbstjustiz gegen Kinderschänder vornimmt“, heißt es weiter. Im nächsten Satz zitiert die Krone einen Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark, der von Straftaten „unter dem Deckmantel der Selbstjustiz“ und einem „Hate-Crime-Delikt gegen eine bestimmte Personengruppe“ spricht.
Der „Deckmantel der Selbstjustiz“, den die Polizei später wiederholen wird, ist wichtig. Das bedeutet nämlich, dass die Täter Selbstjustiz lediglich als Vorwand nutzten, um ihre eigentlichen kriminellen oder ideologischen Motive zu verdecken. Den Tätern ging es nicht um Gerechtigkeit, sondern um Hass. Kein einziges Opfer ist der pädophilen Szene zuzuordnen, stellt die Polizei Freitagmittag klar. Und die Täter seien sich dessen „sehr wohl bewusst“ gewesen, betont der stellvertretende Landespolizeidirektor Joachim Huber.
Die Krone überarbeitet ihren Artikel, nennt die Täter im Titel nun „Dating-Jäger” und die Opfer „mutmaßliche Kinderschänder”. Aber reicht das?