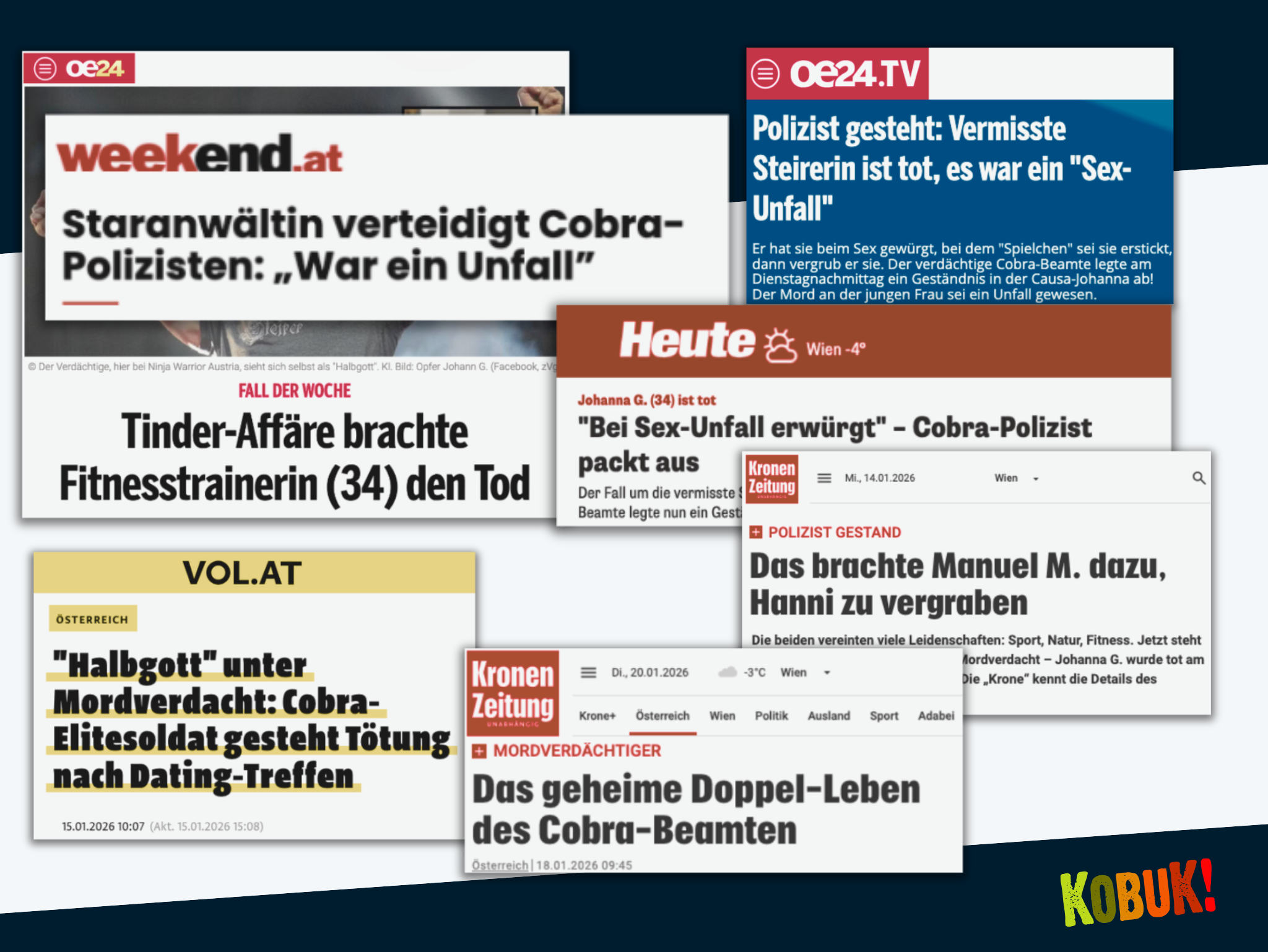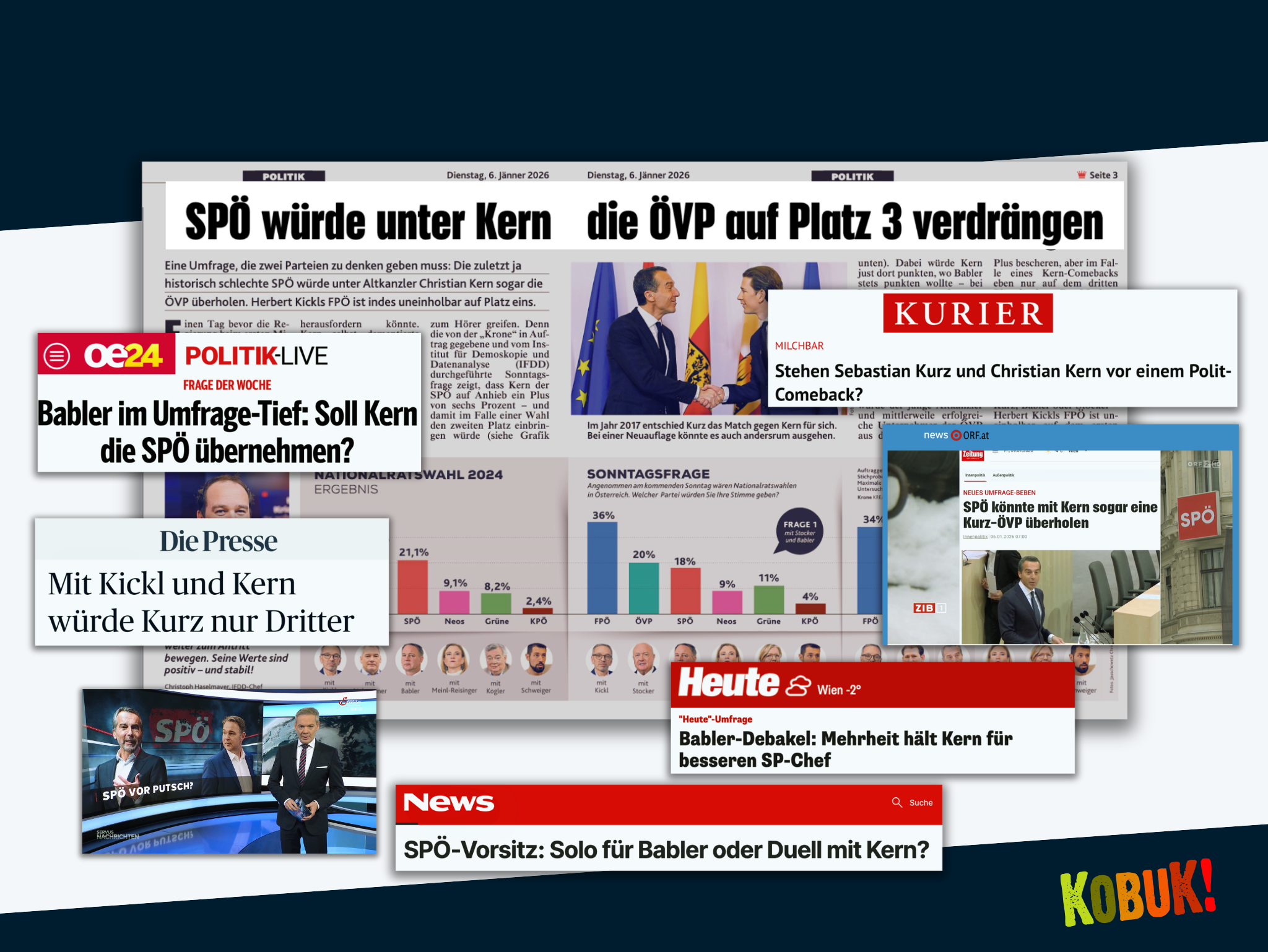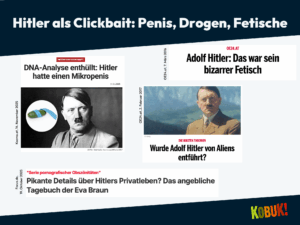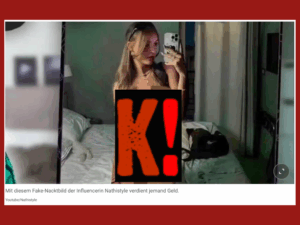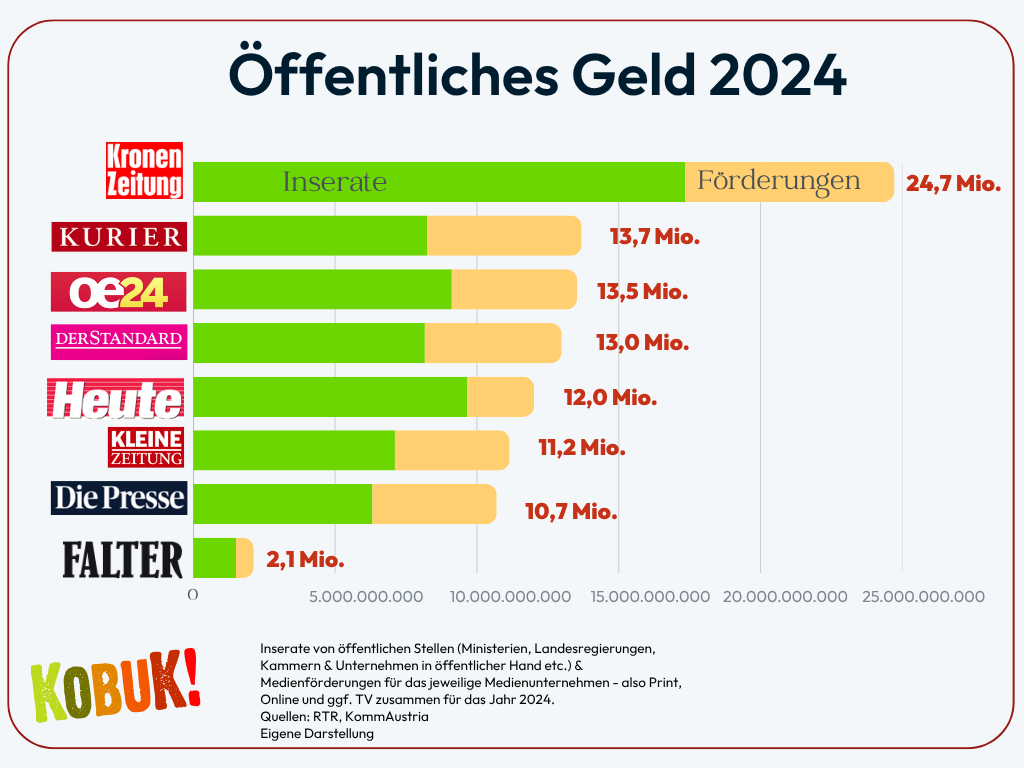Trumps Desinformation hat in deutschsprachigen Schlagzeilen leichtes Spiel. Ob die dokumentierten Erschießungen von Renee Good und Alex Pretti oder die Drohung, Grönland zu annektieren – Medien berichten oft so, als läge die Wahrheit irgendwo zwischen der Propaganda aus dem Weißen Haus und den erwiesenen Fakten. Ein Rückblick auf drei große und mehrere kleine Fälle, in denen Lügen einfach durchgereicht wurden.
Am 24. Jänner erschießt ein Mitarbeiter der US-Einheit ICE den 37-jährigen Alex Pretti. Ein Video zeigt, wie innerhalb weniger Sekunden mindestens zehn Schüsse fallen, Pretti liegt da schon längst am Boden. Die Weltöffentlichkeit sieht, dass der Mann, der ihn erschießt, nicht in Gefahr war. Die US-Regierung behauptet Gegenteiliges, spricht von „Notwehr“.
Trotz der eindeutigen Bilder gibt aber beispielsweise die Kronen Zeitung in ihrer Titelzeile die Version des US-Heimatschutzministeriums wieder: „Ministerium zu Todesschüssen: ‚Plante Massaker‘“. Auch Vol.at, News die Kleine Zeitung und die Salzburger Nachrichten machen das am nächsten Tag mit der APA-Headline „US-Grenzschutz zu Schüssen in Minneapolis: Beamte sind Opfer“. Auf Orf.at schreibt man zunächst nur vorsichtig: „Zweifel an Darstellung von US-Regierung“, ändert die Headline ein paar Stunden später aber in die deutlichere Variante „Video widerspricht Ministeriumsdarstellung“.
Dass Medien die Täter-Opfer-Umkehr der US-Regierung in ihre Schlagzeilen heben und Widersprüche als „Zweifel“ lesen, zeigt vor allem: Es ist noch nicht angekommen, dass Meldungen aus dem Weißen Haus in vielen Fällen bewusste Desinformation sind, die von dem, was tatsächlich passiert ist, ablenken soll. Drei Fakten, die viele Medien nicht klar benannt haben: